OKR: Wundermittel oder alter Wein in neuen Schläuchen?
Eine kurze Einführung

Wer sie nicht schon längst eingeführt hat, sieht sich heute fast schon einer Rechtfertigung ausgesetzt: Warum haben wir noch keine OKR?
Die Rede ist von Objectives and Key Results, dem eng mit dem Silicon Valley verknüpften Zielsystem. Wann immer es um Agilität und Disruption geht, fällt auch schnell dieser Begriff. Was hat es damit auf sich? Sollte das wirklich jeder einführen? Was ist zu gewinnen? Auf was ist dabei zu achten? Ein paar erste Fragen wollen wir hier beantworten.
Zunächst einmal für alle, die es ganz kurz wollen:
Objectives and Key Results ist ein Managementsystem, um Ziele zu setzen und diese über eine ganze Organisation abzustimmen (neudeutsch: zu alignen) und zu tracken.
Das klingt zunächst nicht bahnbrechend neu. OKR sind erst mal auch nicht mehr als eine Weiterentwicklung des klassischen Management by Objectives. Sie gehen auf Andy Grove zurück, der diese in den 1980er Jahren als CEO von Intel entwickelte und damit äußert erfolgreich sein Unternehmen steuerte. John Doerr verbreitete den Ansatz und trug ihn unter anderem auch zu Google, durch die die Methode ihre heutige Popularität erreichte.
Was verspricht OKR?
- Eine Geisteshaltung groß zu denken und ambitionierte Ziele zu verfolgen („to shoot for the moon“).
- Eine Fokussierung des gesamten Unternehmens auf einige wenige wichtige Kernthemen, um diese ambitionierten Ziele auch tatsächlich zu erreichen.
- Eine rigorose Transparenz wer was beiträgt zu gemeinsamen Zielen und wo derjenige damit steht.
- Eine Kultur des gemeinsamen Wollens anstelle einer Kultur des individuellen Müssens.
Unterschiede von OKR und MbO
Dies wird bei OKR erreicht durch einige charakteristische Unterschiede zu herkömmlichen MbO-verwandten Zielvereinbarungssystemen:
| MbOs | OKRs | |
| „Was“ | „Was“ und „Wie“ | |
| Jährlich | Quartalsweise | |
| Privat | Öffentlich | |
| Top-down | Bottom-up und Sideways | |
| An Entlohnung gekoppelt | Entkoppelt von Entlohnung | |
| Konservativ | Ambitioniert |
Das wirklich Neue von OKR
- Während im klassischen MbO primär das Ziel vorgegeben und/oder vereinbart wird, wird bei OKR auch der Weg zum Ziel durch Subziele (Key Results) spezifiziert. Damit wird nicht nur klar, was erreicht werden soll, sondern auch auf welchem Weg. Indem dieser abgestimmt wird zwischen Manager und Mitarbeiter herrscht Einigkeit über Ziel und Weg.
- Die quartalsweise Durchführung hat gegenüber den jährlichen den Vorteil, dass das System weniger statisch ist und agiler auf Veränderungen reagiert werden kann. Der Nachteil soll allerdings nicht verschwiegen werden: Es führt zu einem erheblichen Zeitaufwand, Ziele jedes Quartal über das ganze Unternehmen zu erstellen und abzustimmen. Wird dieser Prozess nicht strikt und diszipliniert durchgeführt, ist das System zum Scheitern verurteilt.
- In den meisten heutigen Anwendungen von OKR werden die Quartals-OKR um zusätzliche Jahres-OKR erweitert, um nicht Gefahr zu laufen, in Aktionismus zu verfallen.
- Die Entlohnung wird in MbO gerne an die Ziele gekoppelt, mit zwei typischen Konsequenzen: 1. Es liegt meist im Interesse aller Beteiligten (mit Ausnahme der Inhaber) Ziele eher konservativ zu setzen, um sie leichter zu erreichen und Bonus zu kassieren. 2. Ziele werden zum Selbstzweck. Selbst wenn sie schlecht gesetzt wurden oder nicht mehr passend sind, werden sie trotzdem verfolgt, um den Bonus zu kassieren. Damit stehen sie der Agilität entgegen. Anders bei OKR: Die Entkoppelung von der Entlohnung ermöglicht es, Ziele ambitionierter zu formulieren, da das bestrafende Korrektiv der Zielverfehlung wegfällt. Da dies nicht bei allen Zielen sinnvoll ist, unterscheidet man bei OKR zwischen commited OKR, also solchen die zu 100% erreicht werden müssen, und aspirational OKR, bei denen man von einer durchschnittlichen Zielerreichung von 70% ausgeht.
- MbO-Ziele werden typischerweise von oben nach unten kaskadiert (also top-down). Der Manager leitet aus seinen Zielen dabei die Ziele für seine Untergebenen ab und gibt ihnen diese vor bzw. vereinbart sie mit ihnen. Auch bei OKR verläuft ein guter Teil des Prozesses top-down. Allerdings werden OKR nicht vorgegeben für die nächste Stufe, sondern der Mitarbeiter erarbeitet seine eigenen OKR als Beitrag zu den OKR der Einheit (Abteilung, Bereich, etc.). Insofern werden OKR auf jeder Stufe bottom-up erarbeitet und abgestimmt. Noch aus einem anderen Grund werden sie allerdings als bottom-up bezeichnet: Das Unternehmen kann auch zulassen, dass in einem gewissen Ausmaß (bis zu 50%) OKR auf unteren Ebenen generiert werden, ohne dass sie auf ein offensichtliches, höheres OKR einzahlen. Auf diese Weise kann ein OKR tatsächlich bottom-up nach oben wandern und OKR auf höherer Ebene nach sich ziehen. Das heißt auch: nicht jedes OKR hat notwendigerweise ein „parent“ oder „child“.
- Besondere Bedeutung hat bei OKR zudem die sideways Abstimmung, also das alignment. Damit ist gemeint, dass OKR auch horizontal mit anderen Einheiten abgestimmt werden. Voraussetzung dafür ist einer der massivsten Unterschiede zwischen MbO und OKR: OKR sind öffentlich und zwar über alle Ebenen hinweg. Und an diese Stelle passt auch eine bedeutsame Warnung: Transparenz in den Zielen bedingt eine Kultur, die geprägt ist von Offenheit, Verantwortungsübergabe, einem positiven Umgang mit Fehlern und gelebtem Feedback. Mangelt es an dieser Kultur, kann man in Anlehnung an ein Sprichwort sagen: „Culture eats OKR for breakfast“. Widerspricht die Kultur dem Ansatz von OKR, verliert OKR. Dann haben sie ein bürokratisches System, das wertlose Ziele verwaltet.
Sind nun OKR also das Wundermittel für fokus-lose Organisationen? Oder doch nur alter Wein in neuen Schläuchen?
- OKR sind das Wundermittel. Richtig eingeführt können Sie Ihre Organisation enorm pushen. Und Sie werden Ihrem alten System keine Träne nachweinen.
- OKR können allerdings schnell auch nur alter Wein in neuen Schläuchen sein, wenn sie bei der Einführung nicht sehr sehr viel Geduld und Sorgfalt walten lassen. Eine Organisation braucht eine Kultur, in der OKR funktionieren kann. Hat sie diese nicht, sollte zuerst die Kultur verändert werden, ehe OKR eingeführt wird. Der Widerstand gegen OKR kann sonst immens ein.
Schreiben Sie mir gerne Ihre Anmerkungen und Fragen rund um OKR. Ich sehe es als großes Privileg Unternehmen und Führungskräfte dabei zu unterstützen, OKR erfolgreich zu etablieren. Denn am Ende profitieren wir alle davon, wenn es noch mehr Unternehmen schaffen, Großes zu leisten für die Menschheit als Gesamtes, mindestens aber für ihre Mitarbeiter und Kunden.
Weiterführende Literatur:
Grove, Andrew (1983). High Output Management. Random House.
Doerr, John (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Penguin Publishing Group.
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, OKR
vom MÜSSEN zum WOLLEN

Während des Leadership Summits eines großen Unternehmens fiel mir auf, dass fast jeder zweite Satz die Worte „wir müssen“ oder „wir sollten“ enthielt: „Wir müssen agiler werden“, „Wir müssen schlagkräftiger werden“, „Wir sollten uns in dem Bereich neu aufstellen“ oder „Wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir unsere Mitarbeiter nicht mehr in Entscheidungen involvieren sollten“.
Nun müssen wir in der Tat recht viel oder glauben zumindest viel zu müssen. Beim Müssen schwingt aber auch mit: Eigentlich wollen wir es nicht. Wir müssen halt. Und wenn wir dann sogar erst noch darüber nachdenken müssen, ob wir es sollen, kann man wohl getrost davon ausgehen, dass hier nichts und zwar gar nichts passieren wird.
Mit einer ganz simplen Frage kann man dann irritieren: Was wollen wir denn? Wollen wir agiler werden? Oder: Von all den Dingen, die wir tun könnten, welche wollen wir denn tatsächlich tun?
Was das für einen Unterschied macht, erlebte ich wenig später in der Diskussion mit zwei Technologie-Start-ups. Die Disruption ist schon in der Sprache spürbar: kein MÜSSEN, aber ganz viel WOLLEN und WERDEN. Man ist nicht getrieben, sondern treibt. Manchmal vielleicht auch aus einer naiven Unwissenheit heraus. Aber ist das nicht immer, was das Neue kennzeichnet?
Mein freundlicher Tipp: Hören Sie auf sich zu stressen, was Sie alles tun sollten oder tun müssen. Und denken Sie mehr darüber nach, was Sie tun wollen. Denn mit dem, was Sie tun wollen, werden Sie viel mehr erreichen in Ihrem Unternehmen, als mit all den Vorsätzen zu Dingen, die Sie lieber nicht tun würden, wenn Sie sich frei entscheiden könnten.
Das ist die wahre Agilität.
Bis bald & be inspired!
P.S.
Und noch eine Ergänzung in eigener Sache: Eine Gruppe von Getriebenen in eine Gruppe von Treibern zu verwandeln, gehört zu den größten Herausforderungen in der Teamentwicklung. Wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an ITO und profitieren Sie von unserem neuen Workshop-Format »Think further«.
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders, Change
Führen mit Motiven vs. Führen mit Zielen

Ich bin in einem früheren Blog schon einmal auf den Umstand eingegangen, dass Ziele nicht motivieren. Und ich propagierte dort ein »Führen mit Motiven«. In der Arzt-Patient-Beziehung kann man eine praktische Anwendung davon sehen:
Führen mit Motiven
Stellen Sie sich vor, Sie haben Zahnschmerzen in einem Backenzahn und suchen deshalb einen Zahnarzt auf. Nun fragt Sie der Zahnarzt, ob Sie bestimmte Beschwerden haben oder bloß zu einer Routineuntersuchung da sind. Damit erfragt er Ihr Motiv als Patient und dieses können Sie gut benennen: Sie haben Zahnschmerzen im Backenzahn. Im Motiv steckt damit auch implizit die Idee, wie das Motiv befriedigt werden soll, nämlich durch das Verschwinden des Schmerzes.
Was Sie vermutlich jedoch nicht machen als Patient, ist, dem Zahnarzt zu sagen was er zu tun hat. Sie vertrauen darauf, dass er mit seiner Kompetenz besser beurteilen kann als Sie, wie Ihr Motiv am besten befriedigt werden kann.
Es kann allerdings sein, dass neben dem Motiv des Zahnschmerzes noch andere Motive eine Rolle spielen wie z.B. das Motiv möglichst wenig Geld auszugeben, oder das Motiv möglichst wenig Zeit zu investieren. Es kann also sein, dass der Zahnarzt Ihnen weitere Fragen stellt oder im Rahmen der Erläuterung der Behandlungsmöglichkeiten weitere Ihrer Motive erfragt und berücksichtigt.
Sie werden aber wohl kein Ziel nennen wie „Es darf nur 500€ kosten“, denn sonst kostet es vielleicht 500€ und den Schmerz haben Sie immer noch. Sie wollen, dass der Schmerz verschwindet und Sie wollen das es möglichst wenig Geld kostet. Aber das mit dem Schmerz ist das Wichtigste. Ihre Motive haben unterschiedliche Prioritäten und Sie wollen, dass der Arzt das versteht und entsprechend handelt.
Führen mit Zielen
Führung in Unternehmen hingegen läuft meist anders: Die Führungskraft ist dabei vergleichbar mit dem Patienten. Denn sie hat ein Anliegen, das der Mitarbeiter erfüllen kann. Anstatt dass sie aber ihr Motiv bzw. ihre Motive nennt und dann dem Mitarbeiter vertraut, sich ein geeignetes Ziel zu setzen und den besten Weg zu wählen, um die Motive zu befriedigen, setzt sie ihm selbst Ziele. Vielleicht weil sie denkt, diese Ziele würde ich mir setzen, wenn es meine Aufgabe wäre, und diesen Weg würde ich wählen, wenn ich selbst handeln müsste – vorausgesetzt sie verfügt überhaupt über die gleiche Kompetenz wie der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter aber verfolgt nun ein Ziel und geht den vorgegebenen Weg, ohne darüber nachzudenken, ob es einen besseren Weg der Motivbefriedigung gäbe, ja vielleicht setzt er den Weg sogar so um, dass das Motiv, das ihm ja nicht bekannt ist, gar nicht befriedigt wird. Noch blöder wenn sich Probleme in der Umsetzung auftun, die niemand vorhergesehen hatte, und nun der Mitarbeiter Alternativziele und -wege erarbeiten muss, ohne genaue Kenntnis, welches Motiv denn eigentlich befriedigt werden soll. Er kennt ja nur das Ziel.
Steve Jobs sagte mal: »It doesn’t make sense to hire smart people and tell them what to do; we hire smart people so that they can tell us what to do.«
Gründe für das Führen mit Zielen
Warum geben Führungskräfte Ziele vor anstelle von Motiven?
- weil Ziele präziser scheinen
- weil es zeitsparender scheint
- weil ihnen selbst nicht klar ist, was eigentlich ihre Motive sind
- weil sie ihre eigene Kompetenz überschätzen
- weil sie die Kompetenz des Mitarbeiters unterschätzen
- weil sie ihrer eigenen Steuerung mehr vertrauen als der Steuerung des Mitarbeiters
- weil sie denken, dass das Ziel zu wenig ambitioniert wäre, wenn es der Mitarbeiter selbst wählt
Aber es geht auch anders
Nehmen Sie sich bei der nächsten Delegation mal vorab ein paar Minuten Zeit und fragen Sie sich: Was sind meine Motive?
Und dann beginnen Sie die Delegation, indem Sie über Ihre Motive sprechen, also das „Warum“, ehe sie dann vielleicht konkreter besprechen, was und wie die Aufgabe angegangen werden soll. Vielleicht vertrauen Sie der Expertise des Mitarbeiters sogar so sehr, dass Sie ihn selbst Ziel und Weg spezifizieren lassen. Das ist Führen mit Motiven.
Im Übrigen muss man dann einem Vorschlag nicht blind folgen. Das gilt auch für den Zahnarztbesuch: Wenn er Ihnen einen Behandlungsvorschlag macht, können Sie auch immer noch hinterfragen, warum er dieses Ziel und jenen Weg vorschlägt. Das ist vielleicht unüblich, aber möglich und sinnvoll. Denn natürlich kann auch der Arzt geleitet sein, Maßnahmen vorzuschlagen, die eher seinen als Ihren Interessen dienen.
Be inspired!
P.S. Inspirierende Führungstrainings zu diesem Thema und anderen finden Sie hier: ITO Führungstrainings
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Anybody Can Be Amazing

A few takeaways from my 25th university reunion at Brown University that you might find interesting:
1. Anybody can be amazing
A friend of mine, now professor at the University of Maryland, brought this to my attention, even if unintendedly: She was talking about a colleague of hers and how amazing she and her work was.
Now I don’t know this colleague or her work and it also might be a bit of a stretch: but the way she talked about that colleague made me realize one thing that I hadn’t really been thinking about since graduating. And that is: anybody can be amazing. And the reason that so many are not, is a gross neglect on the part of their educators, managers and peers. People want to do amazing things. And each and one in their own right is able to do so. We can and want to make a difference. It’s just that so many of us lose that after graduating and we stop striving to do amazing stuff and we and the people around us are content that what we do is mediocre.
Now there’s a lot we can and should do about that. Let’s start with a bold statement about ourselves: I can do something amazing. And continue with: My staff can do something amazing. Yes, it’s that simple. Just stay hungry and don’t settle with anything less than amazing.
2. What’s inspiring
In my daily job as a consultant I typically talk to people that are interested in the same things as I: like agile leadership, sales excellence, training methods, assessment and transformation.
And it hasn’t occurred to me for a long time that as diverse as people seem, that I actually deal with only a tiny portion of people. What I miss out, I came to realize by talking to old friends that work in all sorts of fields – all of them quite foreign to me. And what they had to say, inspired me in ways I hadn’t thought possible.
I spent time with a bartender, a professor for computer science, a film maker, a lobster fisherman. I didn’t seek out to talk to them because I needed something for my job. I was just hanging out really.
But when I came back, I had all that with me. And without planning to, I suddenly started using small things that they had shared with me, in ways no one of us could’ve come up with if we had wanted to.
That reminded me that as a young student at Brown I often had to bridge the time between two classes. And because I had nothing better to do, I sat in classes that I did not attend on subjects that I did not understand – really just to pass the time. Soon I made the interesting observation though that whatever people talked about had an inspiring effect on me. My brain seemed to pick up certain things and placed them in my own field of knowledge thus adding something to it that I otherwise wouldn’t have thought of.
So I realized that inspiring people does not mean to tell someone what to do or how to do it. It’s not about passing on information on something they need to know. It’s definitely not telling people what you know better than them.
What’s really inspiring is hearing something that you were not interested in before, that you did not need, that didn’t directly impact your work – BUT: that allowed you to make new associations. To go beyond what’s obvious. To literally think out of the box.
So the lesson is: If you’re only interested in what you need to be interested in, you miss out on a lot. The most interesting, insightful and inspiring discussions you will probably have with people that do something completely different than you.
3. What’s perfect
The two best dinners I had on my trip were at Sushi Nakazawa in Manhattan, New York and at Erica’s Seafood in Harpswell, Maine.
One was at a fancy restaurant and the most expensive dinner I ever had, the other one of the cheapest that was literally in a garage with two selfmade lobster steamers. But I enjoyed both immensely and I would have a hard time saying which was better. What both restaurants shared, was the desire to make something perfect. It’s not the price that matters. It’s not the location that’s crucial. Anything and anywhere perfection is possible – if there are people that are not content with anything less.
When we Germans sometimes belittle Americans for being overenthusiastic or exaggerating, we miss an important point: Only the ones who believe they can land on the moon, might actually end up on it.
With that, I end for today.
See you next time!
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Das wichtigste Talent:
Die Fähigkeit zur Selbststeuerung

Wahrscheinlich kennen Sie die berühmten Marshmallow-Experimente, die der Psychologe Walter Mischel Ende der 1960er Jahre durchführte: Er gab Kindern z.B. ein Marshmallow und sagte Ihnen „Wenn ihr das Marshmallow nicht esst, bis ich wiederkomme, bekommt ihr noch ein zweites.“ Während es einigen Kindern gelang, sich selbst zu kontrollieren, konnten andere nicht der Versuchung widerstehen, das Marshmallow gleich zu essen. Als er die gleichen Testpersonen Jahrzehnte später wieder befragte, zeigte sich: Diejenigen, die ihr Verlangen kontrollieren konnten, hatten im Schnitt ein höheres Bildungsniveau, mieden Drogen und hatte auch einen niedrigeren Body-Mass-Index. Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle bei so etwas Simplem wie Essensverzicht ermöglichte statistisch signifikante Prognosen.*
Umso erstaunlicher ist, wie wenig Bedeutung bis heute der Selbststeuerungsfähigkeit in Einstellungsprozessen zugemessen wird. Kaum ein Assessment enthält Übungen, die gezielt Selbststeuerung oder Selbstkontrolle messen, ganz zu schweigen von Interviews. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in traditionellen Führungsmodellen die Fähigkeiten zur Selbststeuerung vermeintlich weniger wichtig war – es gab da ja immer noch die Führungskraft, die für eine notwendige Steuerung sorgen konnte.
In heutigen agilen Arbeitswelten wird jedoch aus gutem Grund die Selbststeuerung als wesentliche Voraussetzung für effektives Arbeiten propagiert. Was muss nun jemand mitbringen, der über diese Fähigkeit verfügt? Und wie könnten man sich dessen versichern in Einstellungsverfahren? Diesen Fragen wollen wir hier nachgehen.
Was ist eigentlich Selbststeuerung?
Selbststeuerung ist die Fähigkeit Motive zu priorisieren, Ziele zu entwerfen, Handlungspläne zu entwickeln und diese in kontrollierten Schritten umzusetzen, bis das Ziel erreicht ist oder aufgegeben werden muss.
Hieraus folgt eine zunächst überraschende Erkenntnis: Jeder Mensch verfügt grundsätzlich über die Fähigkeit zur Selbststeuerung. Schon das Kleinkind ist in der Lage, etwa Hunger zu erkennen, sich das Ziel zu setzen etwas zu Essen und Schritte zu unternehmen den Hunger zu stillen, sei es durch Schreien, Weinen, oder auch dem Gang zum Kühlschrank.
Was meinen wir dann, wenn wir sagen: Jemand ist selbstgesteuerter als jemand anderes?
Stellen wir uns zwei Berufsanfänger vor. Während der eine abends Management-Literatur liest, sieht der andere Unterhaltungssendungen. Beide habe Motive, die sie erfolgreich befriedigen. Vielleicht würde sich aber auch derjenige, der abends noch büffelt, lieber entspannen. Was ihn unterscheidet, ist, dass er bestimmte, kurzfristige Motive zurückstellen kann, um andere längerfristige zu erreichen. Auch unser zweiter Mitarbeiter verfügt aber möglicherweise über eine hohe Selbststeuerung: Er will vielleicht nur keine Management-Karriere machen.
Das heißt: Ob jemand eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbststeuerung hat, können wir nur beurteilen, wenn wir seine Ziele kennen und Beispiele, in denen er auf bestimmte, kurzfristige Dinge verzichtet hat, um längerfristige zu erreichen. Wer wirklich Karriere machen will, sollte gewillt sein, andere Dinge hintenanzustellen. Sein Wille sollte sich ausdrücken in seinen Handlungen.
Selbststeuerung heißt aber nicht nur Motive zu priorisieren. Wir können uns auch vorstellen, dass beide dem Ziel der Karriere alles unterordnen und Verzicht üben. Trotzdem gelingt es vielleicht dem einen, einen gangbaren Weg zu planen, während der andere planlos auf sein Ziel zuläuft. Und selbst wenn beide einen Plan haben, kann es immer noch sein, dass einer sich selbst genau kontrolliert während der Umsetzung, während der andere abarbeitet, ohne sich darum zu kümmern, ob denn Zwischenziele auch erreicht werden.
Wie kann man die Fähigkeit eines Mitarbeiters zur Selbststeuerung messen?
Es beginnt mit einer simplen Frage, die Sie sich selbst stellen können: Wie hoch schätze ich die Fähigkeit des Mitarbeiters zur Selbststeuerung ein? Allein diese Frage wird Ihnen ganz neue Erkenntnisse liefern.
Natürlich können Sie den Mitarbeiter befragen aber noch besser ist es ihm eine Aufgabe zu geben und zu beobachten:
- Setzt er sich Ziele?
- Plant er Wege? Und wenn ja, wie: genau, grob, agil, etc.?
- Überprüft er sich selbst bei der Ausführung?
- Traut er sich Korrekturen vorzunehmen, wartet er ab oder handelt er, wenn Probleme auftreten?
Schauen Sie weniger darauf, welches Ergebnis er erreicht, als wie er versucht das Ziel zu erreichen. Das sagt ihnen etwas über seine Selbststeuerungsfähigkeit.
Erhebung der Selbststeuerung in Einstellungsgesprächen
In Einstellungsgesprächen ist eine direkte Beobachtung schwierig. An ihre Stelle muss dann eine Befragung treten, die zeigt, wie sich jemand in der Vergangenheit gesteuert hat.
Beispiele für Fragen:
- Schildern Sie Ziele, die Sie sich in der Vergangenheit gesetzt haben (berufliche wie private, aktuelle wie historische)
- Wie kamen Sie zu Ihrer Entscheidung? (aus dem Bauch, nach Beratung mit Freunden, nach ausgiebiger Recherche, etc.)
- Wie sind Sie vorgegangen diese zu erreichen?
- Gab es Prioritäten, die Sie setzen mussten? Was haben Sie zurückstellen müssen?
- In welchem Ausmaß haben Sie das Ziel erreicht? Was waren die Konsequenzen, die Sie daraus gezogen haben?
Am besten fangen Sie gleich beim nächsten Einstellungsgespräch an oder gehen der Frage nach, wie ausgeprägt die Fähigkeit Ihrer bestehenden Mitarbeiter zur Selbststeuerung ist.
Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!
* Nicht verschweigen will ich, dass in den letzten Jahren vermehrt Kritik an den ursprünglichen Experimenten Walter Mischels bzw. deren Schlussfolgerungen aufkam. Es konnte z.B. nachgewiesen werden, dass das Bildungsniveau der Herkunftsfamilie eine große Rolle spielte in der Fähigkeit das Essen des Marshmallows hinauszuzögern. Noch entscheidender war, wie vertrauenswürdig die Kinder den Psychologen fanden. Kinder alleinerziehender Mütter etwa misstrauten der Zusicherung des männlichen Psychologen, ein weiteres Marshmallow zu erhalten, eher, als Kinder aus „intakten“ Familien. Ihr Verhalten war weniger Ausdruck fehlender Selbstkontrolle, als fehlenden Vertrauens. Einfache Schlüsse, was aus einer Person wird, nur weil sie ein Marshmallow sofort isst, verbitten sich aber ohnedies. Für unseren zentralen Punkt, der Selbststeuerung mehr Aufmerksamkeit zu widmen, sind diese Einschränkungen aber kaum relevant.
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Zähneputzen – eine motivatorische Erfolgsgeschichte

Dass man Mitarbeiter motivieren und nicht nur Ziele setzen muss, leuchtet Führungskräften schnell ein. Nur leider mangelt es dann oft an guten Ideen, wie denn das Motivieren bewerkstelligt werden könnte. Ich bringe dann gerne als erstes eine Methode zur Motivierung, die aus meiner Sicht völlig vernachlässigt wird in der Führung, obgleich sie enorm wirksam ist.
Man kann den Wirkmechanismus am Beispiel des Zähneputzens gut nachvollziehen. Wie bringen Menschen die Motivation auf, zumindest 2x täglich zur Zahnbürste zu greifen und sich die Zähne zu putzen? Man könnte meinen: Weil wir wissen, dass wir sonst Karies oder Parodontitis bekommen, im schlimmsten Fall unsere Zähne frühzeitig verlieren. Das sind rationale Gründe, die einleuchten. Aber wenn ich mir gestern Abend gespart hätte die Zähne zu putzen, wären mir diese heute nicht gleich ausgefallen. Trotzdem habe ich mir brav wie jeden Abend die Zähne geputzt. Und das obwohl ich Zähneputzen relativ lästig finde. Wie lästig es ist, sieht man bei Kindern, die oft einen Aufstand darum machen, als würden sie massakriert. Auch für die Kinder haben wir all die schönen, rationalen Argumente. Sie erzielen nur leider nicht die gewünschte Wirkung, dass sie motiviert, vielleicht sogar intrinsisch motiviert, ihre Zähne putzen würden.
Uns Erwachsenen geht es im Übrigen oft nicht besser: Wir trinken Alkohol, rauchen, betreiben zu wenig Sport, essen zu viel Fleisch etc., obwohl wir genügend rationale Gründe kennen und uns vielleicht sogar schon diesbezügliche Ziele gesetzt haben. Und auch im Job gibt es nur allzu viele Dinge, die rational einleuchtend sind, für die es uns aber dennoch an Motivation dafür mangelt.
Warum also können wir für das Zähneputzen eine Motivation aufbauen und für manch anderes nicht?
Das motivatorische Zauberwort heißt »Gewohnheit«
Wir haben uns schlicht daran gewöhnt, es zu tun und würden es vermutlich selbst dann weiter tun, wenn der ein oder andere rationale Grund wegfallen würde. Vielleicht würde wir es sogar vermissen, wenn wir es einmal nicht mehr tun dürften. Das ist die sprichwörtliche Macht der Gewohnheit.
Dabei haben wir gelernt, eine bestimmte Situation so zu bewerten, dass wir eine bestimmte Gewohnheitshandlung setzen, z.B. Ich habe gerade gefrühstückt, ergo putze ich nun die Zähne. Die Gewohnheit ist als Motiv ebenso wie eine konkrete Handlung. Das Besondere: Sie erfordern keine rationale Entscheidung, sondern werden sozusagen automatisiert abgerufen.
Wäre das nicht toll, wenn Sie als Führungskraft in Mitarbeitern Gewohnheiten aufbauen könnten für all die Dinge, die diese nicht oder nicht so machen, wie es erfolgreicher wäre?
Bleibt die Frage, wie das konkret vonstatten gehen soll, denn eine Gewohnheit kann man leider nicht einfach anweisen.
Eins ist klar: Gewohnheiten taugen nicht für eine einmalige Motivierung, denn es braucht Zeit sie aufzubauen. Ist eine Gewohnheit erstmal etabliert, motiviert sie zum Handeln – aber damit eine Gewohnheit aufgebaut wird, braucht es zunächst andere Motivatoren, die das Verhalten so lange extrinsisch begünstigen, bis es in eine Gewohnheit übergangen ist und sich danach selbst aufrechterhalten kann.
Gewohnheiten als Führungsinstrument
Dazu braucht es:
1. Klarheit welches Verhalten überhaupt zur Gewohnheit werden soll und warum
- Eine klar umrissene Situation, die als Auslöser für das Gewohnheitsverhalten dient (= Motiv)
- Die Verhaltensschritte, die zur Gewohnheit werden sollen (= Weg)
- Eine Belohnung, die auf das gezeigte Verhalten folgt und dieses positiv verstärkt (= Ergebnis)
2. Den Anstoß das Verhalten so lange zu zeigen, bis es zur Gewohnheit geworden ist
Schauen wir uns ein Beispiel an:
Sie wollen die Meetingkultur in Ihrem Team verbessern. Insbesondere das permanente Checken der Handys soll unterbleiben. Das Ergebnis wären produktivere Meetings und weniger Missstimmung.
In welcher Situation soll das Verhalten erfolgen: Zu Beginn von Meetings.
Welches Verhalten soll gezeigt werden: Handys werden ausgeschaltet.
Welche Belohnung folgt auf das Verhalten: Produktivere Meetings mit weniger Ablenkung.
Insbesondere zur Etablierung dieses Verhaltens ist Kreativität und echter Wille gefordert, z.B.:
- Vereinbarung von Standards/Regeln: z.B.: Handys werden in Meetings ausgeschaltet.
- Vereinbarung von Belohnungen/Bestrafungen: z.B.: Bei Missachtung zahlt man 1 € in die „Kaffee-Kasse“
- Einführung von temporären Sachzwängen: z.B.: Handys werden vor dem Meeting eingesammelt.
- Gemeinsames Tun: z.B.: Vor Beginn des Meetings wird aufgefordert, die Handys nun auszuschalten
- Vorbild abgeben: z.B.: Die Führungskraft schaltet demonstrativ zu Meetingsbeginn ihr Handy aus
Die Anstöße zur Etablierung sollten irgendwann unnötig werden, wenn sich einmal die Gewohnheit ausgebildet hat und sich alle „einfach daran halten“.
Es gibt auch Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man Gewohnheiten aufbauen will:
- Vereinbarung von zu ambitionierten/unrealistischen Verhaltensweisen
- Vereinbarung von Verhaltensweisen die wesentlich von Faktoren bestimmt sind, die die Handelnden nicht verantworten
- Gewähren von Ausnahmen
Nun sind Sie gefordert: Starten Sie damit, Gewohnheiten aufzubauen!
Und am besten beginnen Sie damit bei sich selbst, indem Sie Gewohnheit aufbauen für bessere Führung.
Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal!
Weiterführende Literatur:
Charles Duhigg: Die Macht der Gewohnheit. warum wir tun, was wir tun. 1. Auflage. Berlin Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-8270-0957-9 (Originaltitel: The Power of Habit. 2012. Übersetzt von Thorsten Schmidt).
Oder besuchen Sie direkt den Blog von Charles Duhigg.
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Bändigen Sie den Kritiker in sich

Im Rahmen eines Transformationsprojekts machte ich kürzlich folgende Erfahrung, die Sie sicherlich aus eigener Anschauung kennen. Ich moderierte einen Workshop, in dem Mitarbeitern neue, digitalisierte Prozesse vorgestellt wurden, die deren Arbeit beschleunigen und insbesondere ein Kundenerlebnis verbessern sollten. Im Projektteam waren alle überzeugt gewesen, dass diese einen echten Fortschritt darstellen und als Mehrwert begrüßt werden würden. Doch es kam anders: Anstatt dem Neuen mit Interesse und Offenheit zu begegnen, schalteten die Teilnehmer ihren inneren Kritiker auf höchste Stufe und lehnten das Vorgestellte schon ab, ehe sie es überhaupt verstanden hatten. Es war, als würden sie nur eine Frage diskutieren wollen: „Warum muss das der allergrößte Blödsinn sein?“
Genau deswegen braucht es ein gutes Change Management, könnte man meinen. Und das ist sicherlich richtig.
Was mich aber nachdenklich macht, ist, warum viele Menschen überhaupt so ablehnend geworden sind Neuem gegenüber. Es ist ja nicht so, als wären wir so auf die Welt gekommen. Wann ist uns denn diese Neugierde, diese Offenheit abhanden gekommen?
Ich kann mich auch nicht des Eindrucks erwehren, als hätte die heutige Arbeitswelt das noch einmal verstärkt. Ob der Vorgesetzte uns einen Rat gibt, der Kollege oder ein externer Experte… keinem trauen wir so viel zu, als dass wir uns nicht herausnehmen würden, das Gesagte in Frage zu stellen oder gleich kategorisch abzutun. Fremde Sichtweisen sind nicht interessant, sondern falsch.
Fakten stehen alternativen Fakten gegenüber, es ist alles sowieso volatil, unsicher, komplex und ambig (kurz VUKA), Thesen wird mit Antithesen begegnet, nur zur Synthese kommt es immer seltener. Die Diskussion um den Brexit ist wohl das traurigste Beispiel dieses Phänomens.
Ich bemerke bei mir selbst, dass ich oft sehr schnell mit meiner Kritik bin, wenn jemand mit einer Idee auf mich zukommt – natürlich aus gutem Grund, weil ich die Idee schlechter finde als meine eigene. Dabei ist es umgekehrt, als ich denke: Die andere Sicht nimmt mir nicht meine, sondern würde meine erweitern. Indem ich sie abtue, frustriere ich meine Gegenüber und zerstöre eine fruchtbare Diskussion.
Als ich letztens einer HR-Managerin begegnete, die neu in ihrer Position war und beschlossen hatte, erst alle bestehenden HR-Projekte kennenzulernen, ehe sie selbst Akzente setzen wollte, schwante mir deshalb Böses. Auf welche kritischen Fragen würde ich mich in dem von mir verantworteten Projekt einstellen müssen?
Es geschah aber nichts dergleichen. Sie begegnete mir nicht mit der Annahme „da hat mein Vorgänger sicherlich einen Unfähigen ausgewählt, der ein unbrauchbares Projekt managt und dem ich erstmal zeigen muss, was er alles schlecht macht“ – sondern interessierte sich ernsthaft für das Projekt und meine Erfahrungen. Daraus entspann sich in Folge eine Diskussion, in der sie eigene Erfahrungen einbrachte und wir gemeinsam daran arbeiteten, das Projekt noch besser zu machen. Wir hatten uns gegenseitig bereichert, anstatt in unserer festgefahrenen, eigenen Meinung zu verharren. Es war Motivation und Begeisterung entstanden anstelle von Frust.
Eigentlich wissen wir das alle und trotzdem verfallen wir allzu leicht in diesen negativ-kritischen Modus. Man kann es sich nur immer wieder vornehmen und wenn es doch wieder passiert, dessen gewahr werden und aussteigen daraus. Ich selbst will das unbedingt. Und ermuntere andere, mich gerne darauf aufmerksam zu machen, wenn ich einmal wieder zu schnell in den Modus des Kritikers verfalle.
Kritik braucht es. Keine Frage. Aber Kritik haben wir schon im Überfluss. Probieren wir es doch gemeinsam einfach mal aus und stellen eine neue Frage zu Beginn: „Was steckt Interessantes drin?“
Bis bald & be inspired
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Agilität fördern: Ratschläge erteilen vs. Ermutigende Führung
Mir unterlief letztens ein Führungsfehler, der mich auf einen interessanten Unterschied aufmerksam machte, den ich mit Ihnen teilen möchte.

Gut gemeinte Ratschläge
Wir hatten uns für ein großes Projekt bei einem Neukunden beworben und waren zur Präsentation unseres Konzepts (neudeutsch Pitch) eingeladen worden. Diese sollte ein erfahrener Kollege übernehmen. Als er auf der Anreise zu besagtem Pitch war, rief ich ihn an, um ihm zu zeigen: Ich bin in Gedanken bei dir! Wir stehen alle hinter dir.
„Alles klar?“, fragte ich zur Begrüßung, ohne etwas anderes als „Ja, klar!“ zu erwarten und war dann überrascht, als der Kollege das zum Anlass nahm, mir seine Zweifel mitzuteilen. Er machte sich alle möglichen Sorgen, wie die Präsentation laufen würde und sah unsere Chancen eher gering.
Ich selbst schätzte unsere Chancen eher hoch ein, begann mir allerdings in dem Moment auch Sorgen zu machen, ob es dem Kollegen gelingen würde, unser Konzept mit Begeisterung zu präsentieren. Ich überlegte mir: Wie würde ich das machen? Und ich dachte an den Kollegen und fragte mich, was er alles schlechter machen könnte. Und dann lief ich zur Höchstform als Führungskraft auf: Ohne mich lang mit seinen tatsächlichen Sorgen aufzuhalten, referierte ich über die Schwächen des Kollegen, was ich beobachtet hatte, was früher schon mal schief gelaufen war, was ich anders (und natürlich besser) machen würde und ich gab ihm eine Reihe an Ratschlägen, die – wenn er sie nur befolgen würde – ganz bestimmt für den Erfolg sorgen würden. Ich selbst würde es so machen und wäre siegesgewiss.
Als ich geendet hatte und er das tatsächlich widerspruchslos über sich hatte ergehen lassen, passierte allerdings etwas für mich in dem Moment Unerwartetes. Auch wenn es jetzt, da ich es aufschreibe und sie das lesen, natürlich alles andere als unerwartet und eher sogar extrem offensichtlich ist: Der Kollege war noch kleinlauter als zu Beginn unseres Gesprächs. Er bestätigte, was ich gesagt hatte, sähe es ähnlich, wüsste trotzdem nicht wie er es machen sollte. Seine Selbstzweifel und Sorgen waren noch größer geworden. Vielleicht kennen Sie ja auch den Ausspruch „Ratschläge sind auch Schläge“. Eigentlich hätte er gleich umkehren und nach Hause fahren können. Der Pitch war verloren. Sein Problem lag an ganz anderer Stelle: An fehlendem Selbstvertrauen. Und dazu hatte ich keinen positiven Beitrag geleistet, im Gegenteil. Meine Ratschläge hatten ihn allenfalls entmutigt.
Ermutigende Führung ist agile Führung
Was hätte er stattdessen gebraucht?
Eine Bestätigung, dass er alles mitbringt, um diesen Pitch zu rocken! Dass ich das Vertrauen in ihn habe. Dass er so oft schon gezeigt hat, dass er so etwas kann. Vielleicht auch: Dass wir nichts zu verlieren und nur zu gewinnen haben. Er hätte meine Zuversicht spüren können. Ich hätte ihn ermutigen können, das zu tun und sich so zu geben, wie er es am besten kann. In der Sicherheit, dass das den besten Beitrag leistet, den Auftrag zu holen, denn:
- Fremdakzeptanz führt zu Selbstakzeptanz
- Fremdvertrauen führt zu Selbstvertrauen
- Ermutigung führt zu Selbstsicherheit
Und Selbstsicherheit ist nicht zuletzt die Voraussetzung für Selbststeuerung und agiles Arbeiten.
Ich habe mir deshalb eines geschworen: Bei der nächsten Gelegenheit mehr darüber nachzudenken, ob es vielleicht eher an Selbstvertrauen mangelt, als an Skills. Und dann etwas zur Steigerung des Selbstvertrauens zu unternehmen und zu ermutigen, anstatt Ratschläge zu erteilen.
P.S.
Den besagten Pitch haben wir tatsächlich verloren, belegten aber immerhin den 2. Platz von 15 Beratungen. Gewonnen hatte eine Agentur, die schon an einem ähnlichen Projekt für den Kunden arbeitete und ihm bestens bekannt war.
Das Entscheidende für mich als ermutigende Führungskraft war aber nicht, dass wir den Auftrag verloren hatten. Sondern dass wir so gut waren, dass wir als Zweitbester abgeschnitten hatten. Ich war stolz auf das Team und den Kollegen, der diese tolles Ergebnis erzielt hatte – in der Sicherheit, dass ihm das nächste Mal auch ein erster Platz gelingen wird.
Bis bald!
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Hat der Purpose schon wieder ausgedient?

Purpose ist zweifelsohne eines der Management-Schlagwörter der Stunde. Auch ich habe erst unlängst zu diesem Thema geblogged („For those who make the world“). Und wie es solche trendigen Wörter so an sich haben, wird man ihrer schnell überdrüssig. Zunächst als Allheilmittel gepriesen, verliert es bald an Glanz, die kritischen Stimmen werden lauter, bis es schließlich abgelöst wird von einem neuen Trend. Während die Manager deutscher Konzerne gerade alle auf „Sinnsuche“ sind, wird dies bereits von der Tages- und Fachpresse als reiner Marketing-Gag abgetan. Siehe hierzu den Artikel „Von Kapitalisten zu Weltverbesserern?“ von Georg Meck in der FAZ.
Das ist schade. Denn die Frage nach dem Purpose hätte es verdient, zum Standard-Repertoire in Führungsetagen zu werden – und nicht nur in solchen. Denn von einem echten Purpose profitiert in der Tat jeder: Kunden, Mitarbeiter, Investoren. Das Problem ist nur, dass bei vielen Managern nur hängengeblieben ist: „Wir brauchen einen Purpose, um noch erfolgreicher zu sein.“, wodurch der Purpose zum reinen Mittel verkommt. Aber Purpose ist kein Weg zu einem Ziel, keine Antwort auf die Frage „Wie können wir in einer digitalen, agilen Welt die Konkurrenz ausstechen?“. Wir brauchen keinen Purpose, um besser Ziele zu erreichen, sondern wir entscheiden, unsere Ziele nur zu erreichen, wenn sie auch einem bestimmten Purpose dienen. Der Purpose liegt in der Hierarchie über den Zielen, nicht unter diesen. Purpose macht Arbeit nicht erfolgreicher – sondern sinnvoller!
Das haben viele Unternehmen nicht verstanden und sie formulieren einen Purpose, der nur Mittel ist, nur Marketing. Auch das kann funktionieren, um z.B. Mitarbeiter der Generation Y oder Z anzuziehen, denen man nachsagt, sie arbeiten lieber für ein Unternehmen mit attraktivem Purpose. Mit einem reinen Marketing-Purpose wird aber eine große Chance vertan.
Ein Purpose, der wirklich Mitarbeiter wie Manager eines Unternehmens antreibt, schafft Motivation, über ein reines Zahlen-Erwirtschaften hinauszugehen. Das heißt nicht, dass der Profit unwichtig wird – aber er steht eben nicht mehr an erster Stelle. Das ist im Übrigen nichts Ungewöhnliches. Auch eine Compliance steht oder sollte zumindest über den Zielen eines Unternehmens stehen. Man entscheidet sich eben Gewinne auf legale Art und Weise zu erzielen. Das tut der Zielorientierung kaum Abbruch. Ähnlich ist es mit dem Purpose. Er garantiert keine Zielerreichung, er steht ihr aber auch nicht im Wege. Man kann mit Sinn Profite realisieren und mit Sinn non-profit-orientiert arbeiten. Beides geht im Übrigen auch ohne Sinn.
Was es braucht, ist demnach keine Abkehr von der Sinnsuche. Eher eine noch größere Hinkehr, aber auch ein echter Versuch zu erarbeiten, für welchen Sinn wir arbeiten wollen. Nicht weil er sich gut in einer Marketing-Broschüre macht, sondern weil wir dafür tatsächlich gerne in der Früh aufstehen und uns an die Arbeit machen.
P.S.
Wir haben bei ITO selbst lange um unseren Purpose gerungen. Korrekter wäre es wohl zu sagen: Wir ringen weiter darum. Dieses Ringen trägt aber schon jetzt Früchte. Wir haben für uns herausgefunden, dass wir Menschen nicht nur beraten, coachen, trainieren wollen. Und schon gar nicht nur möglichst viel Geld damit verdienen wollen. Sondern dass wir Menschen inspirieren. Danach streben wir, danach richten wir unsere Interventionen aus. Darüber freuen wir uns, wenn es gelingt und bedauern, tut es dies mal nicht. Hat es uns erfolgreicher gemacht? Das wird man sehen. Fühlt es sich sinnvoller an? Unbedingt!
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders
Mitarbeiter motivieren, ohne den Menschen zu verändern
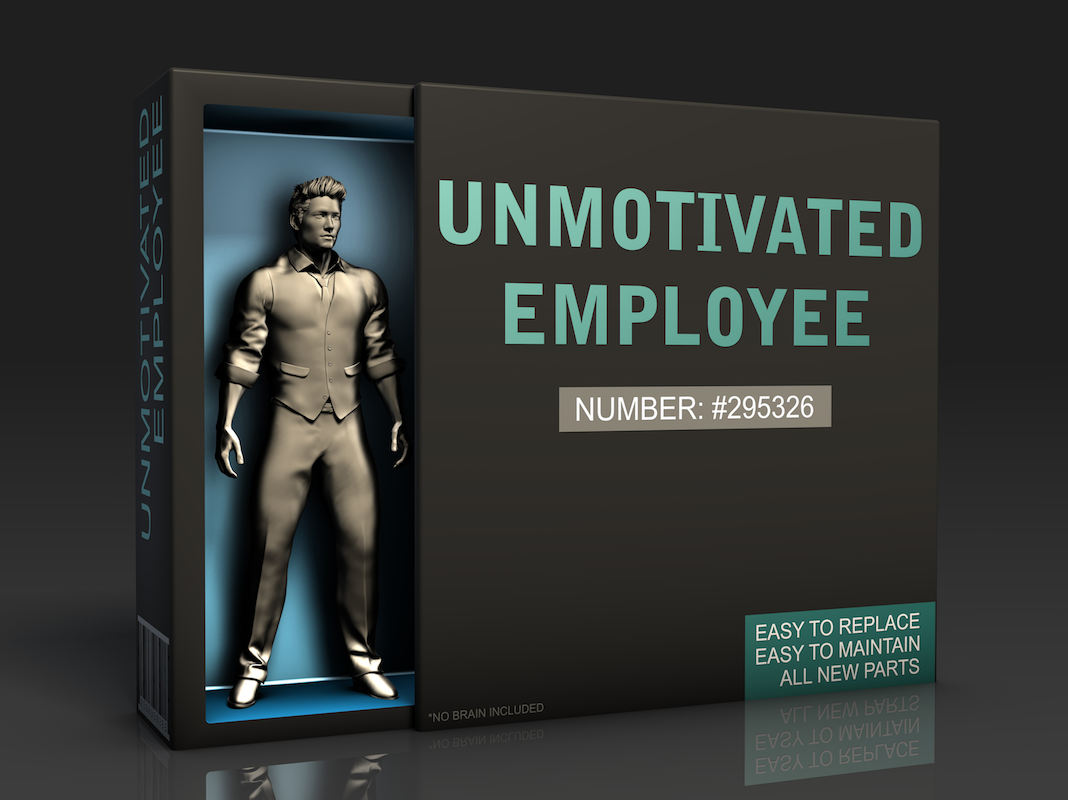
Führungskräfte klagen mir gegenüber oft über Mitarbeiter, die nicht genügend intrinsisch motiviert wären. Mit intrinsisch meinen sie: Es reicht den Mitarbeitern nicht, eine ihnen übertragene Arbeit einfach machen zu dürfen. Sie wollen auch noch etwas dafür bekommen. Nicht nur Geld, sondern auch Wertschätzung, Anerkennung, Karriereaussichten, usf. Als wäre die Aufgabe an sich nicht attraktiv genug.
„Wir brauchen andere Mitarbeiter“, sagen sie, „aber die finden wir leider nicht.“ Wegen diesem unseligen War for Talents.
Wie viel einfacher wäre der Job der Führung, wenn man diese sagenumwobenen Talente hätte, die einfach nur wegen ihrem intrinsischen Interesse an der Sache arbeiten, die sich selbst im Sinne des Unternehmens ausbeuten ganz altruistisch, nur weil sie die Arbeit so befriedigt. Was wäre das für eine schöne Welt! Die Realität sieht aber leider meist anders aus. Was also tun?
An dieser Stelle kommt vielen Führungskräften eine Idee, die sie dann konsequent verfolgen: Wir müssen den Mitarbeiter ändern, ihm diese Motivation einfach abverlangen, ihn notfalls zwingen, mit aller Macht. Und das versuchen sie dann, auch wenn sie darin scheitern und jeden Tag aufs Neue bewiesen bekommen, wie wenig sich Menschen ändern und ändern lassen wollen. Im schlimmsten Fall entsteht daraus Unzufriedenheit und innere Kündigung – aber selbst im besten wohl kaum Motivation.
Viele Möglichkeiten ein Ziel zu erreichen
Dabei gibt es eine Alternative, bei der allerdings all unsere Kreativität gefordert ist.
Das ist die Veränderung von Aufgaben, um sie motivierender zu machen.
Auf diese Idee kommen Führungskräfte aber oft nicht, weil die Aufgabe ja vermeintlich vorgegeben ist. Es muss ja eine bestimmte Aufgabe gemacht werden und man braucht nur jemanden, der sie erledigt. Eine Aufgabe ist aber nicht mehr als eine Möglichkeit zu einem Ziel zu gelangen. Es gibt unzählige Varianten dieser Aufgabe und unzählige Varianten zu dieser Aufgabe. Und während es unglaublich schwierig ist, den einen Mitarbeiter zu finden, der zu einer spezifischen Aufgabe passt, ist es vergleichsweise einfach eine Aufgabe zu gestalten, die zu den tatsächlich vorhandenen Mitarbeitern passt. Das heißt nicht zu fragen, „Wer ist intrinsisch für eine Aufgabe motiviert?“, sondern „Für was ist jemand intrinsisch motiviert, das zur Aufgabengestaltung verwendet werden kann?“.
Situationen gestalten statt Mitarbeiter verändern
Wenn also Aufgabe und Mitarbeiter nicht zueinander passen, muss nicht der Mitarbeiter, sondern sollte zunächst die Aufgabe verändert werden. Die Aufgabe wiederum ist Teil einer Situation, die zum Handeln anregt. So gesehen reicht es, eine Situation so zu gestalten, dass der Mitarbeiter selbst animiert ist, eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen.
Das klingt hoffentlich alles nachvollziehbar und trotzdem wahnsinnig kompliziert. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt: Was mache ich konkret mit dieser Einsicht? Wie kann man sie praktisch umsetzen?
Ein Beispiel für motivierende Situationsgestaltung
Ein Beispiel soll Ihnen eine erste Idee geben:
Bei einem Kunden aus der Versicherungsbranche hatten die angestellten Makler nicht nur die Aufgabe Verkaufsgespräche zu führen, neue Kunden zu gewinnen und Potenzialausschöpfung bei bestehenden Kunden zu machen. Darüber hinaus sollten Sie die gesamte Kundenverwaltung erledigen, Briefe schreiben, Versicherungsfälle aufnehmen und bearbeiten sowie zu guter Letzt auch noch neue Makler rekrutieren.
Dieses breite Aufgabenportfolio führte in der Praxis dazu, dass insbesondere die Rekrutierung in den vielen Vertriebsgebieten vernachlässigt wurde. In anderen wiederum gab es Defizite in der Neukundengewinnung oder Kundenverwaltung.
In einer Analyse zeigte sich, dass unter den bestehenden Maklern nur etwa 5% für Personalakquisition motiviert waren. Weitere 20% hatten eine besondere Motivation für Verwaltungsaufgaben.
Mit dieser Information fiel die Lösung leicht:
Die bestehende Position „Makler“ wurde aufgeteilt. Nun gibt es „Recruiter“, die nur noch ihrer Passion Recruiting nachgehen. Es gibt „Verwalter“, die sich nur um die Kundenverwaltung kümmern. Und es gibt „Verkäufer“, die, entlastet von den Aufgaben, die sie noch nie mochten, sich nun voll und ganz auf den Vertrieb konzentrieren können.
Niemand wurde gezwungen, niemand musste motiviert werden, einzig die Situation wurde verändert.
Das ist motivierendes Leadership.
Bis bald
- Veröffentlicht in Inspiring Leaders











